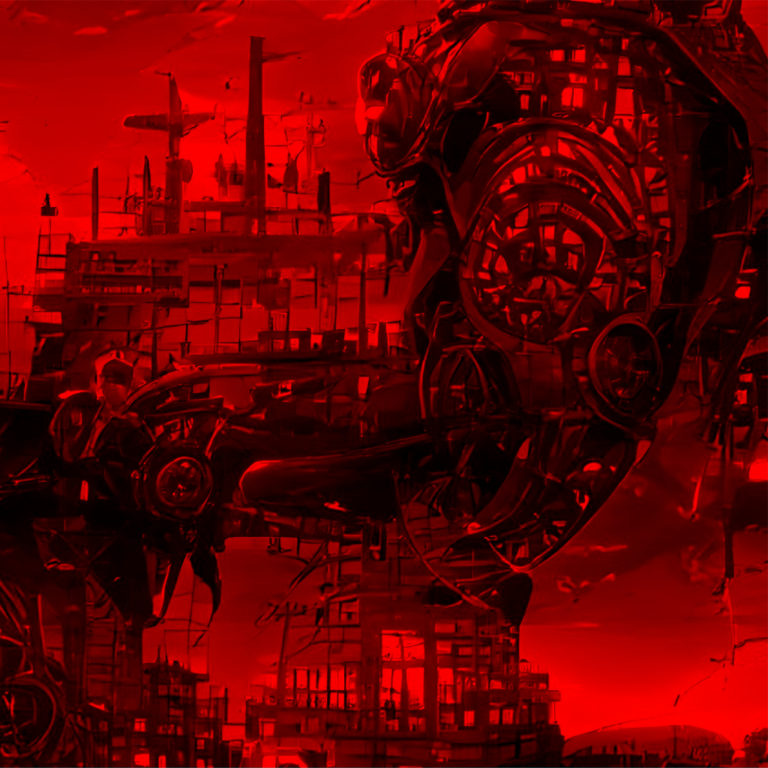Luka Hinse und seine Familie leben in einem Stück Urwald auf der Nordinsel Neuseelands. Ihr Haus besteht weitgehend aus recycelten Materialien, sie sind nicht mit der öffentlichen Strom- und Wasserversorgung verbunden und haben in den letzten Jahren sehr viel darüber gelernt, was es heißt, den Energieverbrauch an Tages- und Jahreszeiten auszurichten und welche kleinen Annehmlichkeiten besonders teuer sind. Ein Ausblick in die Zukunft, ein Abenteuer oder ein Stresstest für die Familie?
Im Podcast erzählt Luka auch, wie seine Söhne das deutsche und neuseeländische unterschiedlich erleben und welche Rolle die Maori Kultur in Neuseeland spielt.
Joachim Stein interviewt Jörg Ossenkopp zu dessen zweiter Reise nach Ruanda, wo Jörg ein Team von Software Entwicklern aufbaut. Im Gespräch erzählt Jörg von seinen Erfahrungen mit dem Team und von seinen Exkursionen in Kigali und Umgebung zu Fuß und mit dem Rad, sowie einem Trip in den Volcanoes Nationationalpark im Norden des Landes, wo man Berggorillas begegnen kann.
In „Gleich, später, morgen“ geht es um die Bewohner eines Züricher Wohnviertels Anfang der 90er Jahre. Der Briefträger bekommt einen Einblick in deren Leben und greift in guter Absicht ein.
Der Titel „The Dawn of Everything“, einem Buch, dass der 2021 verstorbene David Graeber und David Wengrow gemeinsam geschrieben haben, sagt bereits, dass es sich hier um einen Rundumschlag handelt. Den Aufschlag bildet die große These, zentrale Ideen der Aufklärung hätten ihren Ursprung in den Ideen nordamerikanischener indigener Bevöklerungen und deren zum Teil belustigter Kommentare zu den Machtstrukturen der Europäer, die sie nicht als freie Menschen ansahen.
Im Weiteren versuchen Graeber und Wengrow zu zeigen, dass die Vorstellung einer linearen Zivilisationsgeschichte, die sowohl Rousseau als auch sein Gegenspieler Hobbes mit umgekehrten Vorzeichen vertreten, ein Mythos ist. Auch die in den Wissenschaften heute vorherrschende These, die Entwicklung moderner Staaten und ihrer Bürokratie sei eine Folge der Einführung des Ackerbaus und systematischer Landwirtschaft, wird nach Graeber und Wengrow nicht von archäologischen Funden gestützt. In diesem Rahmen enthält das Buch auch interessante Auslassungen zu Prinzipien der Freiheit und Prinzipien der Herrschaft, die die Handschrift des bekennenden Anarchisten David Graeber tragen.
Graeber und Wengrow in einer dialogischen Präsentation:
https://www.youtube.com/watch?v=EvUzdJSK4x8
Wie könnte es aussehen, wenn Berlin sich als Zentrum oder „Hub“ für nachhaltige Start-Ups positioniert? Kann das funktionieren und wäre das gut? Nicolas und Jörg fänden das natürlich beide toll, beleuchten die Möglichkeiten und Herausforderungen, die das Feld zwischen Start-Ups, Stadtpolitik und Nachhaltigkeit bieten, in dieser holzfrei Folge aber noch etwas genauer.
Nicolas ist Gründer von Pollion, eines Start-Ups, das sich hauptsächlich in der nachhaltigen Bio-Branche bewegt hat, genauer: in der mobilen Marktforschung. Außerdem ist Nicols er ist in der Politik aktiv. Er hat in Stanford und Oxford studiert und an der HU in Politikwissenschaften promoviert.
Johannes Osterhoff hat sich als Künstler mit Benutzeroberflächen beschäftigt und in Langzeit-Performances mit Öffentlichkeit in unserer vernetzten welt experimentiert. Er arbeitet aber auch als Designer in einem großen Unternehmen.